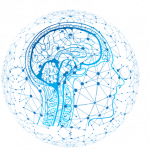In den letzten Wochen hat die Corona-Pandemie unser aller Leben privat wie beruflich dramatisch verändert. Umfangreiche Verhaltens- und Hygieneregeln wurden von Bund und Ländern eingeführt. Dabei erschwert die föderale Struktur das Bemühen, bundesweit den Überblick über die geltenden Regelungen zu behalten. Inzwischen wurden Lockerungen der Auflagen in Aussicht gestellt und erste Schritte eingeleitet. Unser Leben scheint sich wieder etwas zu „normalisieren“ – zumindest vorerst.
Auch wenn ein Rückblick in der aktuellen Situation noch etwas voreilig sein mag, ist aber doch sicherlich festzustellen, dass es den Regierungen auf Bundes- und Landesebene recht gut und schnell gelungen ist, sich an diese besondere Situation anzupassen. Entsprechende Vorkehrungen wurden im Gesundheitswesen getroffen und mit umfangreichen Maßnahmenpaketen wird versucht, größeren Schaden von der Wirtschaft fern zu halten. Die Bundesregierung hat konsequent „den Menschen“ vor „die Wirtschaft“ gestellt. Die damit verbundenen haushaltswirksamen Maßnahmen und ihre Folgen belaufen sich aktuell auf über 550 Milliarden Euro und der Umfang der Garantien auf zusätzlich rund 820 Milliarden Euro.
Die Bundesregierung geht von erheblichen Wachstumseinbußen in diesem Jahr und dementsprechend von einem gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizit von 7,25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) aus. Für die gesamtstaatliche Maastricht-Schuldenquote rechnet die Bundesregierung mit einem Anstieg von 59,8 Prozent im Jahr 2019 auf knapp unter 80 Prozent des BIP.
Der Staat hat somit – zunächst – die gesellschaftlichen Kosten der Corona-Krise übernommen. Natürlich stellt sich folglich früher oder später die politische und gesellschaftliche Frage, wie mit den resultierenden Staatsschulden umgegangen werden soll. Getreu dem Motto „die Schulden von heute sind die Steuern von morgen“ liegt es da natürlich nahe, höhere staatliche Einnahmen über zusätzliche Steuern zu generieren. So schlägt die LINKE zur gerechten Kostenverteilung eine einmalige dynamisch gestaltete Vermögensabgabe von zehn Prozent (oder mehr) für das eine Prozent der vermögendsten Privatpersonen in Deutschland vor. Freibeträge für die selbstgenutzte Immobilie sowie Betriebsvermögen sollen dabei als Ausgleich für die „ärmeren“ Vermögenden vorgesehen werden. Die SPD liebäugelt ebenfalls mit einer Vermögensabgabe, und die Grünen lehnen sie zumindest nicht kategorisch ab.
Tatsächlich träfe eine Vermögensabgabe genau die Unternehmen und Unternehmer, insbesondere im Mittelstand, die die großen sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Krise wie Auftragseinbrüche, Personalausfälle und unterbrochene Lieferketten bislang durch spontanes und agiles Handeln gemeistert haben. Sie haben bereits jetzt hohe Lasten schultern müssen und wenig von den staatlichen Hilfen profitieren können. Denn dem Mittelstand wurden – abgesehen von Kurzarbeitergeld – vor allem zinsvergünstigte Kredite und die Stundung von Steuern und Sozialabgaben als Liquiditätssicherung angeboten.
Dies mag bei sinkenden Erlösen und fortbestehenden Kosten im Grunde sinnvoll und kurzfristig notwendig sein, führt aber letztlich zu Rückzahlungsverpflichtungen und diese können langfristig existenzbedrohend sein. Durch die Liquiditätshilfen wird die Verschuldungskapazität der Unternehmen belastet und somit könnten wichtige Zukunftsinvestitionen verdrängt werden. Die gegenwärtigen Probleme können daher im Wesentlichen nur durch Eigenkapital nachhaltig gelöst werden. Eine zusätzliche Belastung unternehmerischer Vermögen ist daher kontraproduktiv.
Sollen oder können die Einnahmen nicht erhöht werden, so richtet sich der Blick auf die Ausgabenseite: In den letzten Jahren ist es der Bundesregierung bei wohlwollender Betrachtung gelungen, den Bundeshaushalt zu konsolidieren und durch erzielte Überschüsse Schulden abzubauen. Bei genauer Betrachtung der Haushaltsentwicklung der letzten Jahre wird jedoch augenscheinlich, dass zum einen die Rekordeinnahmen an Steuern und Beiträgen und zum anderen auch die historisch niedrigen Zinsausgaben der letzten Jahre die hohen Steigerungsraten der übrigen Ausgaben, insbesondere die der Sozialausgaben, verschleiert haben.
In der aktuellen geopolitischen Situation wird man vermutlich nicht an den Ausgaben für die Verteidigung sparen wollen, und auch zukunftssichernde Ausgaben für Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen und Bildung nicht kürzen wollen. Die Kürzung von staatlichen (Sozial-)Leistungen böte insofern sicherlich die größten zu realisierenden Einsparpotenziale auf der Ausgabenseite. Dem würde sicherlich entgegengehalten, dies träfe vor allem die Schwächsten der Gesellschaft, also Menschen mit keinem eigenen oder eher geringem Einkommen.
Was also bleibt übrig als Handlungsoption?
Vielleicht sollte die Regierung tatsächlich einfach nichts tun: Die aus der Corona-Krise resultierenden zusätzlichen Staatsschulden könnten im aktuellen Niedrigzinsumfeld, das aufgrund der weltweit hohen Sparquote und der demografischen Situation voraussichtlich weiter anhält, zu sehr niedrigen Zinsen langfristig finanziert werden. Zur Tilgung wird auf wieder steigende Staatseinnahmen durch Wirtschaftswachstum gesetzt, und das an der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen ausgerichtete progressive deutsche Steuersystem sorgt quasi „automatisch“ für Verteilungsgerechtigkeit der Tilgungslasten.
Aufgrund der krisenbedingten Verunsicherung sinkt aktuell jedoch der private Konsum, während gleichzeitig die Unternehmen ihre Investitionen dramatisch herunterfahren. Um die Konjunktur perspektivisch wieder anzukurbeln, müssen daher zusätzlich deutliche Signale gesetzt werden, die Bürger und Unternehmen motivieren und die mittel- und langfristig wieder eine hohe Beschäftigung und Wachstum herstellen. Voraussetzung: Die Kauflaune steigt, wenn die Verunsicherung über Arbeitsplatzsicherheit und Einkommensperspektiven nachlässt. Zu diesem Zweck brachten Bundesregierung und Große Koalition nun zusätzlich ein Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket mit einem Volumen von 130 Milliarden Euro auf den Weg. Als zentrale Säule zur Stärkung des Konsums sind eine zeitlich befristete Senkung der Umsatzsteuer und ein Kinderbonus vorgesehen. Auch die Unternehmen sollen steuerlich entlastet werden, indem u. a. der Verlustabzug erweitert, eine Corona-Rücklage eingeführt und eine degressive Abschreibung ermöglicht wird sowie die Gewerbesteueranrechnung bei der Einkommensteuer und die steuerliche Forschungsförderung verbessert werden. Diese Maßnahmen sind im Ergebnis positiv für die Liquiditätslage der Unternehmen, sie sind jedoch teilweise befristet und entfallen später.
Da jedoch durch die Corona-Krise nicht alleine ein Nachfrageschock ausgelöst wurde, wie im Rahmen der Finanzkrise 2009, sondern es sich um eine Überlagerung von Angebots- und Nachfrageschock handelt, sollte die Regierung nur begrenzt auf das altbewährte wirtschaftspolitische Instrumentarium zurückgreifen: Klassische Konjunkturprogramme (z. B. Kinderboni) zur Belebung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage wirken in dieser Konstellation nämlich genauso eingeschränkt wie angebotsorientierte Maßnahmen (z. B. Sonderabschreibungen). In den Betrieben bestehen ungenutzte Kapazitäten, jedoch können diese mangels Kauflaune u. a. aus Angst vor Arbeitsplatzverlust oder gestörter Lieferketten nicht reibungslos und ausreichend ausgelastet werden, so dass die Maßnahmen weitgehend verpuffen dürften. Das Paket gibt mithin kurzfristige Konjunkturimpulse, aber keine anhaltenden Entlastungen und Perspektiven.
In der Post-Corona-Zeit sollte die Politik auf steuerliche Impulse setzen, die nachhaltige Investitionsanreize bieten, somit Arbeitsplätze sichern und in Zeiten globaler Umbrüche – Stichwort Digitalisierung – auch dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft dienen. Sicher gehört Mut dazu, in Zeiten wegbrechender Staatseinnahmen die Steuern nicht zu erhöhen, besser noch gezielt zu senken. Berechtigter Anlass bestünde: Der Anteil der Steuereinnahmen am Bruttoinlandsprodukt, die Steuerquote, hat im Jahr 2019 mit 24,0 Prozent unter der Großen Koalition den höchsten Stand seit Verwirklichung der deutschen Einheit erreicht. Und die letzte Unternehmenssteuerreform liegt inzwischen über zehn Jahre zurück. Die Corona-Pandemie könnte somit nicht nur als Herausforderung für Gesellschaft und Wirtschaft gesehen werden, sondern auch als Chance, wirtschafts- und sozialpolitische Rahmenbedingungen entschlossen zu erneuern und zu modernisieren und dabei den Bürgern auch wieder mehr Eigenverantwortung zuzutrauen und vor allem zu geben.
von: Dr. Dirk Jandura, Geschäftsführer der Oskar Böttcher GmbH & Co. KG, Mitglied des VEG-Vorstands und des BGA-Gesamtpräsidiums, zugleich Vorsitzender des BGA-Ausschusses für Steuern und Finanzen

Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Auszug aus der Juli-Ausgabe der ElektroWirtschaft.